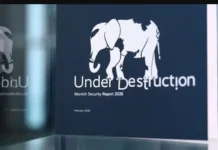Nicolas Sarkozy vor Gericht – Der Schatten der libyschen Millionen
Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy steht im Mittelpunkt eines der
aufsehenerregendsten politischen Skandale der letzten Jahrzehnte. Seit Jahren ermitteln
französische Behörden wegen des Verdachts, dass Sarkozy im Wahlkampf 2007 illegale Gelder
vom libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi erhalten haben soll. Nun hat ein Gericht in
Paris ein historisches Urteil gesprochen, das Frankreich erschüttert.
Das Pariser Strafgericht verurteilte Sarkozy im Jahr 2025 wegen „krimineller Verschwörung“
im Zusammenhang mit der Wahlkampffinanzierung. Zwar wurde er von einigen weiteren
Anklagepunkten freigesprochen, doch das Urteil bleibt beispiellos: Zum ersten Mal in der
Geschichte der Fünften Republik wurde ein ehemaliger Präsident für die Annahme illegaler
ausländischer Gelder in Verbindung mit einer erfolgreichen Wahlkampagne verurteilt.
Das Gericht verhängte eine fünfjährige Haftstrafe gegen den 70-Jährigen. Ein Teil der
Strafe könnte mit elektronischer Fußfessel oder Hausarrest verbüßt werden, doch das Urteil
bleibt gültig – selbst wenn Sarkozy Rechtsmittel einlegt. Damit setzten die Richter ein
deutliches Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und gegen politische Korruption in Frankreich.
Der Fall reicht zurück bis ins Jahr 2005. Damals war Sarkozy französischer Innenminister
und bereitete seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2007 vor. Ermittler gehen
davon aus, dass er eine geheime Vereinbarung mit Gaddafi traf: Millionenbeträge sollten aus
Libyen nach Frankreich fließen, um den Wahlkampf zu unterstützen. Im Gegenzug versprach
Sarkozy offenbar eine engere Zusammenarbeit mit dem Regime, das international unter Druck
stand und dringend politische Anerkennung im Westen suchte.
Mehrere Zeugen berichteten im Laufe der Jahre von Bargeldkoffern, die nach Paris gebracht
wurden. Französische und libysche Mittelsmänner, Geschäftsleute und selbst bekannte
Kriminelle sollen Teil des Netzwerks gewesen sein. Dokumente, die 2012 von der Plattform
„Mediapart“ veröffentlicht wurden, deuteten ebenfalls auf Zahlungen in Millionenhöhe hin –
doch die Verteidigung von Sarkozy bezeichnete sie stets als Fälschungen.
Sarkozy selbst weist die Anschuldigungen kategorisch zurück. Er sprach von einer
„politischen Verschwörung“, die darauf abziele, seinen Ruf zu zerstören. Immer wieder
betonte er, dass er niemals Geld aus Libyen angenommen habe und dass die Beweise nicht
ausreichten. Auch während der aktuellen Gerichtsverhandlung im Jahr 2025 versuchte er,
die Glaubwürdigkeit der Zeugen infrage zu stellen.
Die Staatsanwaltschaft blieb jedoch bei ihrer Linie. Sie sah es als erwiesen an, dass
Gaddafi persönlich grünes Licht für die Unterstützung Sarkozys gegeben habe. Der
libysche Diktator, der 2011 während des Arabischen Frühlings gestürzt und getötet wurde,
hatte zuvor mehrfach öffentlich behauptet, die französische Wahl finanziert zu haben.
Besonders brisant sind die Verbindungen zwischen Sarkozys Umfeld und der libyschen
Regierung. Mehrere enge Mitarbeiter des Präsidenten mussten sich ebenfalls vor Gericht
verantworten. Manche von ihnen wurden wegen Beihilfe, Korruption und Urkundenfälschung
verurteilt. Damit zeigt sich, dass der Skandal nicht nur Sarkozy betrifft, sondern auch
ein ganzes Netzwerk innerhalb der französischen Politik offenlegt.
Beobachter betonen, dass dieser Prozess nicht nur eine juristische Angelegenheit ist,
sondern auch ein tiefer Einschnitt in die politische Kultur Frankreichs. Die
Auseinandersetzung erinnert die Öffentlichkeit daran, wie sehr Geld und Macht miteinander
verflochten sein können – und wie schwer es ist, diese Verbindungen transparent zu machen.
Trotz seiner juristischen Niederlagen bleibt Sarkozy eine prägende Figur der französischen
Rechten. Selbst nach seiner Amtszeit zwischen 2007 und 2012 hatte er großen Einfluss auf
die Partei „Les Républicains“. Viele seiner Anhänger sehen in ihm ein Opfer einer
politischen Kampagne, während Kritiker ihn als Symbol für die Korruption in höchsten
Staatsämtern betrachten.
Die französische Justiz hat in den letzten Jahren mehrfach harte Urteile gegen Sarkozy
gefällt. Bereits 2021 wurde er wegen Korruption und Einflussnahme verurteilt. Später
bestätigten Berufungsgerichte diese Urteile. Nun ist die Verurteilung im Zusammenhang mit
den libyschen Millionen ein weiterer Meilenstein, der das Bild des Ex-Präsidenten massiv
beschädigt.
Internationale Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In europäischen Hauptstädten
wurde das Urteil aufmerksam verfolgt. Viele Medien betonten, dass Frankreich mit diesem
Schritt die Unabhängigkeit seiner Justiz unter Beweis stelle. Kritiker im Ausland warnten
jedoch davor, dass der Fall die politische Stabilität Frankreichs belasten könne.
Auch in Nordafrika hat das Urteil für Aufsehen gesorgt. Libyen selbst steckt weiterhin in
einem fragilen politischen Prozess. Die Enthüllungen über die engen Kontakte zwischen Paris
und dem Gaddafi-Regime werfen Fragen über die Außenpolitik Frankreichs in den 2000er-Jahren
auf. Sie zeigen, wie weit westliche Staaten bereit waren, mit einem international
umstrittenen Regime zusammenzuarbeiten.
Sarkozy bleibt derweil kämpferisch. Seine Anwälte haben angekündigt, in Berufung zu gehen.
Sie wollen das Urteil anfechten und sprechen von einer „ungerechten Entscheidung“. Doch
die Chancen stehen schlecht: Zu viele Indizien, Aussagen und Dokumente belasten den
Ex-Präsidenten.
Für Frankreich ist der Fall Sarkozy ein Spiegelbild einer größeren Krise: dem Kampf gegen
Korruption, Machtmissbrauch und den Einfluss von Geld in der Politik. Er zeigt, dass selbst
höchste Staatsämter nicht vor der Justiz sicher sind. Ob dieses Signal ausreicht, um das
Vertrauen der Bürger in die Demokratie zu stärken, bleibt jedoch offen.
Eines ist sicher: Der Prozess gegen Nicolas Sarkozy wird als einer der wichtigsten
politischen Prozesse des 21. Jahrhunderts in die Geschichte Frankreichs eingehen. Er
verdeutlicht, dass Macht und Verantwortung untrennbar miteinander verbunden sind – und dass
selbst die einflussreichsten Politiker nicht über dem Gesetz stehen.