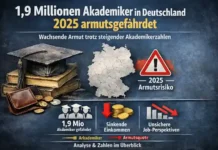Neue Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen ein alarmierendes Bild über die soziale Lage vieler Kinder und Jugendlicher in Deutschland: Im vergangenen Jahr war nahezu jedes siebte Kind unter 18 Jahren von Armutsgefährdung betroffen. Insgesamt belief sich die Zahl dieser Minderjährigen auf rund 2,2 Millionen, was einem Anteil von 15,2 Prozent entspricht und damit deutlich über dem Wert von 2023 liegt, als die Quote noch bei 14 Prozent lag. Trotz dieser Zunahme steht Deutschland im europäischen Vergleich weiterhin besser da, da der EU-Durchschnitt bei 19,3 Prozent liegt. Dennoch machen Experten deutlich, dass die Entwicklung nicht nur statistische Bedeutung hat, sondern tiefgreifende gesellschaftliche Folgen mit sich bringt.
Als armutsgefährdet gilt nach der offiziellen Definition, wer weniger als 60 Prozent des sogenannten „äquivalisierten Nettoeinkommens“ zur Verfügung hat – ein Wert, der die Haushaltsgröße berücksichtigt. Für das Jahr 2024 lag diese Schwelle für eine alleinstehende Person bei 1381 Euro monatlich. Haushalte eines alleinerziehenden Elternteils mit einem Kind unter 14 Jahren gelten bereits ab einem Monatseinkommen unter 1795 Euro als armutsgefährdet, während zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren als gefährdet eingestuft werden, wenn ihr monatliches Einkommen unter 2900 Euro liegt.
Besonders deutlich zeigt sich die Ungleichheit bei Kindern mit Migrationshintergrund: Laut den Statistiken liegt das Risiko der Armutsgefährdung bei Minderjährigen, die selbst nach Deutschland eingewandert sind oder deren beide Elternteile migrantische Wurzeln haben, bei drastischen 31,9 Prozent. Im Gegensatz dazu beträgt die Quote bei Minderjährigen ohne Migrationshintergrund lediglich 7,7 Prozent – ein Unterschied, der auf fast das Vierfache hinausläuft. Als zentraler Risikofaktor wurde zudem ein niedriger Bildungsstand der Eltern identifiziert, der häufig mit einem geringeren Einkommen einhergeht und langfristig die Chancen der Kinder auf soziale Teilhabe beeinträchtigt.
Die Auswirkungen von Armut sind nicht abstrakt, sondern wirken sich konkret und spürbar auf das alltägliche Leben der Betroffenen aus. Um die soziale und materielle Deprivation messbar zu machen, arbeiten die Statistiker mit einem Katalog aus 17 Merkmalen, die verschiedene Formen der Teilhabe abbilden – von der Möglichkeit, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, bis hin zu grundlegenden materiellen Bedürfnissen. Ein Kind gilt dann als materiell oder sozial benachteiligt, wenn mindestens drei dieser Merkmale aus finanziellen Gründen nicht erfüllt werden können.
In Deutschland trifft dies auf 11,3 Prozent der Kinder unter 16 Jahren zu, während der EU-Wert bei 13,6 Prozent liegt. Besonders gravierend ist der Befund, dass 19 Prozent der unter 16-Jährigen in Haushalten leben, die nicht in der Lage sind, kaputte oder verschlissene Möbel zu ersetzen. Für 12 Prozent ist selbst eine einwöchige Urlaubsreise finanziell nicht realisierbar, und 3 Prozent verfügen nicht einmal über ein zweites Paar geeigneter Schuhe.
Sozialverbände warnen seit Jahren, dass solche Einschränkungen langfristige Auswirkungen auf Selbstwertgefühl, Bildungschancen und gesellschaftliche Integration haben. Armutsgefährdung bedeute nicht nur finanzielle Knappheit, sondern auch ein erhöhtes Risiko sozialer Isolation, psychischer Belastung und gesundheitlicher Nachteile. Trotz der vergleichsweise günstigen Position Deutschlands im europäischen Kontext macht der Bericht deutlich, dass strukturelle Probleme ungelöst bleiben und vor allem Kinder mit Migrationshintergrund weiterhin überdurchschnittlich stark betroffen sind. Experten fordern daher gezielte politische Maßnahmen, die über kurzfristige finanzielle Unterstützung hinausgehen und Bildungs-, Integrations- sowie Sozialprogramme stärker in den Mittelpunkt rücken.